
«Wir stecken mitten in einer Polykrise»
Um unsere Zukunft nicht zu gefährden, müssten wir jetzt handeln, sagt Sandrine Dixson-Declève, die Co-Präsidentin des Club of Rome. Die Wissenschaft spiele eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Nachhaltigkeit – aber es brauche mehr als neue Technologien, um die multiplen Krisen in den Griff zu bekommen, in denen sich die Menschheit befinde.
Sandrine Dixson-Declève, lässt Ihre Arbeit als Co-Präsidentin des Club of Rome Sie oft schlaflos, wütend oder depressiv werden?
Wie viele, die auf diesem Gebiet arbeiten, schwanke ich zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Es gibt Momente, in denen ich optimistisch bin. In denen ich sehe, dass wir die meisten Lösungen haben, die wir brauchen. Dass wir Entscheidungsträger haben, die zuhören. Aber leider ist das oft nicht der Fall. Wenn ich momentan zum Beispiel sehe, wie Erdöl- und Gasbohrungen zunehmen oder wie Regierungen nach rechts schwenken, dann werde ich sehr besorgt. Wir stecken mitten in einem planetaren Notstand – und die meisten Menschen haben das Gefühl, wir könnten weitermachen wie bisher.
Trotzdem scheinen Sie nicht ganz zu verzweifeln.
Dana Meadows, die Hauptautorin des Club-of-Rome-Berichts «Die Grenzen des Wachstums», sagte einmal: «Es gibt zu viele gute Nachrichten, um zu verzweifeln, aber zu viele schlechte Nachrichten, um selbstzufrieden zu sein.» Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir müssen jeden Tag daran denken, dass es gute und schlechte Nachrichten gibt. Aber wir müssen die Hoffnung behalten.
Bis heute ist der Club of Rome am bekanntesten für «Die Grenzen des Wachstums», das vor mehr als 50 Jahren erschien. Meadows und ihre Mitautoren warnten damals vor katastrophalen Folgen, sollten wir nichts unternehmen gegen Bevölkerungswachstum, Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Unterernährung und Ausbeutung nicht erneuerbarer Ressourcen. Haben sich diese Herausforderungen bis heute verändert?
Ich glaube, es sind ungefähr dieselben geblieben. Die Weltbevölkerung ist in den letzten 50 Jahren weiter gewachsen. Das belastet die natürlichen Ressourcen weiter. Im letzten Herbst bestätigte ein Bericht des Stockholm Resilience Centre, dass wir von neun planetaren Grenzen sechs bereits überschritten haben. Genau das sagte «Die Grenzen des Wachstums» voraus für den Fall, dass wir mit einer Rohstoffwirtschaft weiterfahren, die Produktivität um jeden Preis will.
Manche Beobachter kritisierten, die Prognosen des Berichts hätten sich nicht bewahrheitet.
Manche Leute sagen: «Aber wir haben das Ölfördermaximum nicht überschritten. Wir haben immer noch natürliche Ressourcen.» Ja, das stimmt. Der Report sagte nicht, wir hätten keine Ressourcen mehr. Er zeigte, dass mit dem Bevölkerungswachstum der Zugang zu Ressourcen schwieriger wird. Und dass es kombinierte Effekte von sozialen und ökologischen Spannungen gibt.
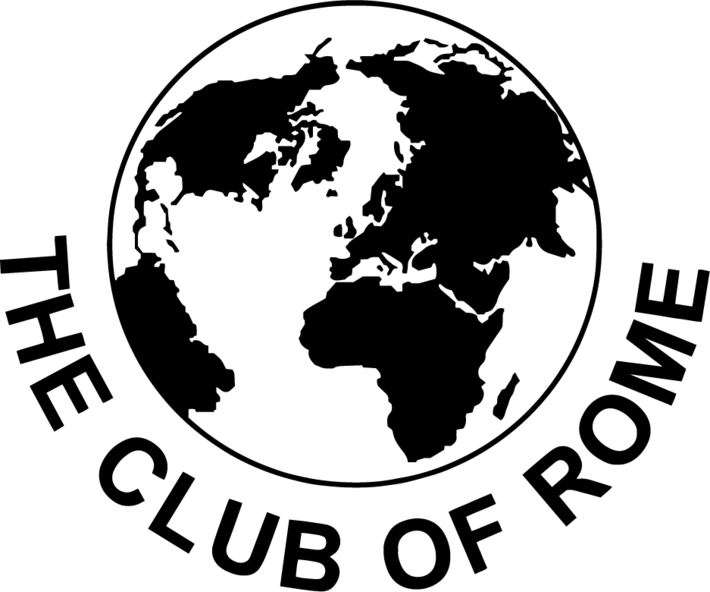
Club of Rome
Der Club of Rome ist ein Zusammenschluss von Experten verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die gemeinnützige Organisation wurde 1968 gegründet und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. 1972 publizierte er die vielbeachtete Studie «Die Grenzen des Wachstums». Die Studie warnte damals vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten im 21. Jahrhundert, sollte die Gesellschaft insbesondere bei der Nutzung natürlicher Ressourcen nichts ändern.
Welches ist das wichtigste Problem, mit dem wir heute konfrontiert sind?
Wir sehen heute ein Nebeneinander von sozialen und Umwelt-Kipppunkten. Wenn man sich die Szenarien in «Grenzen des Wachstums» anschaut, dann zeigten sie, dass in den 2020er-Jahren eine Serie von starken Kipppunkten erreicht sein könnte. Nun sind wir in den 2020er-Jahren: Und wir stecken mitten in einer Polykrise – mit einer Klimakrise, mit einer Gesundheitskrise, mit der Ukraine-Invasion, aber auch mit einer Biodiversitätskrise. Wir haben zum 50-Jahr-Jubiläum von «Die Grenzen des Wachstums» ein Buch geschrieben, «Earth for All», um diese Spannungspunkte und mögliche alternative Zukunftsszenarien anzusprechen.
Welches Fazit ziehen Sie in Ihrem Buch?
Wir zeigen, dass die soziale Krise der grösste Kipppunkt sein wird. Und wahrscheinlich unsere grösste existenzielle Bedrohung. Die Ungleichheit in den reichsten Nationen, etwa den USA oder Grossbritannien, nimmt zu. Und die Ungleichheit zwischen reichen und armen Ländern hat exponentiell zugenommen. Das führt zu sozialen Spannungen, begünstigt autoritäre Regimes, destabilisiert Demokratien und ist ein Nährboden für Populismus.
Und solche Entwicklungen können dann überschwappen auf andere Probleme wie die Klimakrise?
Genau. Wobei es nicht ein Überschwappen ist, sondern ein Zusammenwirken. Wir sehen zum Beispiel, dass höhere Temperaturen in Indien eine direkte Auswirkung haben auf die Art, wie Männer ihre Frauen behandeln. Es gibt mehr Aggression, mehr häusliche Gewalt.
Weshalb?
Zum einen machen heissere Temperaturen Menschen automatisch aggressiver. Zum anderen wachsen mit der Klimaerwärmung ihre Ängste – mit der Hitze wachsen in diesem Fall männliche Aggressionen, weil die Ernten kleiner werden. Die Männer machen sich Sorgen, dass sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Wer hätte gedacht, dass einer der Folgeeffekte des Klimawandels mehr Aggression ist? Aber genau darum geht es bei der systemdynamischen Modellierung und dem Systemdenken. Mit dieser Methode lassen sich komplexe Systeme untersuchen – und beispielsweise eine Reihe miteinander verknüpfter Spannungspunkte identifizieren.
Gibt es weitere solche kombinierte Effekte?
Wir sahen dasselbe in der Corona-Krise, als die Menschen häufiger drinnen blieben. Auch das hatte einen Einfluss auf die häusliche Gewalt – besonders in Familien, die in engen Verhältnissen leben. Oder die Ukraine-Invasion kombiniert mit dem sehr, sehr trockenen, heissen Sommer in Frankreich, Italien und Spanien. Das führte zu einem starken Preisanstieg bei Lebensmitteln und zu Unterbrechungen der Wertschöpfungskette. Wir vergessen oft, dass es solche kombinierte Effekte gibt. Und dass es direkte Auswirkungen einer Polykrise und der Beziehung zwischen komplexen Systemen sind.
«Ich schwanke zwischen Hoffnung und Verzweiflung.»
In «Earth for All» schlagen Sie fünf Pfade vor, aus dieser Krise zu kommen: Sie betreffen Armut, Ungleichheit, Selbstbestimmung, Energie und Ernährung. Sehen Sie in einigen dieser Bereiche Fortschritte?
Es geht nicht mehr um einzelne Bereiche. Die fünf müssen zusammenwirken. Manche Menschen glauben zum Beispiel, wir könnten alles durch Technologie lösen. Technologische Erfindungen gelten als hype, als sexy. Aber mit Technik allein lösen wir das Ungleichheits- und das Armutsproblem nicht. Wir brauchen mehr: Wir brauchen die richtige Staatsführung, um die ökonomischen und Finanzsysteme neu zu verkabeln – und um neue technische Lösungen im nötigen Tempo und in der nötigen Skala zu ermöglichen. Aber mit dem politischen und wirtschaftlichen Wandel tun wir uns schwer.
Einer Ihrer Vorschläge ist die Einführung einer universellen Grunddividende: Unternehmen würden für ihren Verbrauch von Ressourcen besteuert, die eigentlich der Gemeinschaft gehören: Wasser, Land, Mineralien, fossile Energien, Daten. Bewegt sich etwas in diese Richtung?
Norwegen und Alaska haben Systeme, die unserem Vorschlag sehr ähnlich sind. Sie geben der Bevölkerung jedes Jahr einen Check oder Steuerrabatte – so sieht diese, wie die Global Commons, die natürlichen Ressourcen, geteilt werden. Nur ist der Anteil nicht sehr gross, verglichen mit den Profiten der Firmen.
Ganz allgemein ist eine der wichtigen Forderungen des Club of Rome eine Ausrichtung der Wirtschaft auf Nachhaltigkeit, weg vom Wachstum, das sich nur am Bruttoinlandsprodukt orientiert. Wie wollen Sie das erreichen?
Es ist nicht die Wirtschaft, die sich bewegen wird. Es sind die Regierungen, die neue Indikatoren schaffen müssen, welche die Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts, der Produktivität abschwächen. Indem sie anderen ökonomischen Indikatoren wie dem Zugang zu sozialen Leistungen, Wohnraum, Gesundheitswesen und Bildung mehr Gewicht beimessen. Indem sie externe Kosten besteuern, welche Energie oder Nahrungsmittel verursachen. Indem sie dem einen echten Wert geben, was für das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen am wichtigsten ist. Das passiert nicht. Aus diesem Grund haben wir einen Wohlstandsindex entwickelt. Er zeigt, dass das allgemeine Wohlbefinden zwar vor allem in Ländern mit hohem Einkommen bis Anfang dieses Jahrzehnts gestiegen ist. Insbesondere in den letzten Jahren verzeichnen wir jedoch einen dramatischen Rückgang des Wohlbefindens der Menschen – aufgrund der Pandemie, der ukrainischen Invasion und der Inflationseffekte.
Weshalb?
Es gab eine völlige Abkopplung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft. Wir sehen, dass der grösste Teil des Profits in die Taschen der Aktionäre oder von Interessengruppen geht statt in die produzierende Wirtschaft. Dass es keinen sozialen Kontrakt gibt. Wenn ein Unternehmen viele Menschen entlässt, gehen die Aktien hoch. Das ist gut für die Firma und die Aktionäre. Aber die Entlassungen verursachen Kosten für die Sozialsysteme, die Gesellschaft und die individuellen Lebensbedingungen.
Also geht es wieder um Ungleichheit.
Ja.

Sandrine Dixson-Declève
Sandrine Dixson-Declève ist Co-Präsidentin des Club of Rome, gleichberechtigt mit dem indischstämmigen Nachhaltigkeitsexperten Paul Shrivastava. Die in den USA aufgewachsene Belgierin hat Umweltwissenschaften, Ökonomie und Internationale Beziehungen studiert. Sie hat die UNO, die EU, Regierungen auf der ganzen Welt, Unternehmen, akademische Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen zu Nachhaltigkeit, neuen Wirtschaftsmodellen, Klima- und Energiepolitik beraten. Das Medienunternehmen GreenBiz zählt sie zu den 30 einflussreichsten Frauen weltweit, die den Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft vorantreiben und grüne Unternehmen fördern. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Club of Rome hat sie gemeinsam mit renommierten Mitautorinnen und -autoren «Earth for All» veröffentlicht, um aufzuzeigen, wie die Menschheit die grossen Probleme der Welt in den Griff bekommen kann.
Sandrine Dixson-Declève, Owen Gaffney, Jayati Ghosh, Jørgen Randers, Johan Rockström, Per Espen Stoknes: «Earth for All – Ein Survivalguide für unseren Planeten», Oekom Verlag, 2022
In «Earth for All» schreiben Sie, dass die Menschheit an einem Scheideweg steht. Wie viel Zeit bleibt uns, um die richtigen Weichen zu stellen?
Uns bleibt keine Zeit mehr, wir müssen es jetzt tun. Wir sind bei einer Erderwärmung von 1,2 Grad angelangt und werden höchstwahrscheinlich 1,5 Grad im Jahr 2030 erreichen. Wir sehen schon jetzt grosse Auswirkungen, sogar in Europa: Überflutungen, Trockenheiten, Waldbrände. Zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung werden die Auswirkungen noch grösser werden. Verbunden mit den klimatischen Kipppunkten sind gravierende soziale Kipppunkte. Das ist die Hauptaussage des Buches: Die Gesellschaft steht an einem Scheideweg, weil soziale und ökologische Kipppunkte zusammenkommen.
Welche Rolle spielt die Wissenschaft dabei, einen Wandel zu ermöglichen oder zu beschleunigen?
Wissenschaft ist grundlegend. Auf ihr gründen unsere Modelle. Wir brauchen die Wissenschaft aber auch bei laufenden politischen Verhandlungen, zum Beispiel über Klimamassnahmen. Leider bemerken wir hier ein Auseinanderdriften: Die Wissenschaft wird zwar immer robuster in Bezug auf ihre Voraussagen, doch in den Verhandlungen wird dieses neue Wissen nicht einbezogen. Zusätzlich gibt es Teile von Regierungen, Teile der Wirtschaft, die überhaupt nichts wissen wollen von einem Wandel. Denn es würde heissen, dass sie Änderungen anschieben müssten. Und sie wollen weder Macht noch Profit verlieren. Hier wird es zunehmend angespannter. Zwischen den Mächtigen und Leuten wie mir oder aus den Wissenschaften oder der Jugend, die sagen: Es ist nicht mehr die Zeit, sich einfach an die Macht zu klammern. Wir müssen die Dinge anders angehen, um nicht nur unsere individuellen Interessen zu schützen, sondern auch die kollektiven.
«Die soziale Krise ist unsere grösste existenzielle Bedrohung.»
Was können Wissenschaftsstiftungen wie die Werner Siemens-Stiftung zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen?
Ich glaube, Stiftungen müssen die heutige Rolle der Wissenschaft verstehen. Wissenschaft und Forschung dürfen nur einen Fokus haben: die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, innerhalb der planetarischen Grenzen zu gedeihen. In einer Zeit, in der wir uns in einer planetaren Krise befinden, müssen wir alle unsere Forschungsgelder dort investieren, wo es wirklich wichtig ist. Die Wissenschaft darf nicht im Elfenbeinturm bleiben, sie muss sich fokussieren auf die wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und Resultate müssen rasch umgesetzt und skaliert werden. Denn in vielen Fällen sind Forschung und Innovation viel zu langsam. Ich bin auch Vorsitzende der «Expert Group on the Economic and Societal Impacts of Research and Innovation» für die Europäische Kommission. Dort arbeiten wir daran, Wissenschaft relevant zu machen für die politische Entscheidungsfindung. Wir sehen, dass politische Entscheidungsträger wissenschaftliche Erkenntnisse oft nicht zur richtigen Zeit bekommen – dann, wenn sie Entscheidungen treffen müssen.
Nicht nur Politiker müssen Entscheidungen treffen, sondern jeder Mensch. Und wir alle wissen, dass der Klimawandel eine Bedrohung für uns darstellt und dass wir Ressourcen nicht unbegrenzt verbrauchen können. Dennoch gibt es viele – nicht nur jene an der Macht – die nichts tun. Wie erklären Sie sich diese Kluft zwischen Wissen und Handeln?
Die Menschheit ändert sich vielfach erst dann, wenn ein Schlag sie mitten ins Gesicht trifft. Das ist die Vogel-Strauss-Taktik: Wir stecken unsere Köpfe in den Sand. Die Menschen sind besorgt, ängstlich, einige haben aufgegeben. Sie sind zynisch geworden gegenüber ihren Regierungen. Aber ich glaube, wenn man ihnen eine hoffnungsvolle Vision gibt, eine alternative, positive Zukunft, dann sind sie bereit für den Wandel.
Und wie gibt man ihnen diese Vision?
Wir haben eine Umfrage in allen G20-Ländern durchgeführt. Darin erklärten 74 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass sie einen Wandel hin zu einer Wirtschaft wünschen, die ein grösseres Wohlergehen für alle und nicht nur für einige wenige gewährleistet. Dies ist die Kernaussage unseres Buches und diejenige, über die ich vor Regierungen und anderen Zuhörern spreche. Ich glaube, es ist nicht clever, Ängste zu schüren. Dafür wird die Umwelt- und Klimabewegung oft kritisiert. Ich bevorzuge es, die Dinge als Herausforderung anzuschauen – vielleicht, weil ich in den USA aufgewachsen bin. Wer ein Rennen läuft, weiss, dass es hart wird. Was einen antreibt, ist das Gefühl, wenn man das Ziel erreicht hat, das Gefühl des Sieges. Es wird ein Marathon, den wir laufen müssen – und wir müssen den Menschen irgendwie die Belohnung aufzeigen, die am Ende auf sie wartet. Nämlich, dass sie ein ganzheitliches, positives Leben werden führen können.



